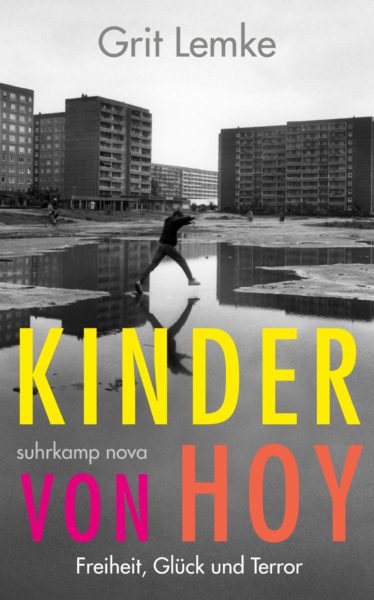Tatsächlich werde in Wildau gebaut, vor allem aber so, dass es für normale Leute unerschwinglich sei. »Zum Glück haben wir eine Kommunale Gesellschaft und eine Genossenschaft. Die bieten vernünftige Mieten – aber beide haben lange Wartelisten.« Derzeit wird in Wildau über ein privates Großprojekt gestritten: Ein Investor will Wohnungen für bis zu 1 800 Menschen bauen. Ob das Abhilfe schafft? Hillebrand ist skeptisch: Zwar sei das Vorhaben halbwegs sozialverträglich, neben Eigentum seien auch Mietwohnungen geplant. »Aber ein Projekt dieser Größe zieht vor allem neue Leute an. Das macht unsere Infrastruktur nicht mit: Zu wenige Kitas, zu wenige Schulen und außer der S-Bahn kaum öffentlicher Nahverkehr. Uns droht ein Verkehrschaos.«
Nicht nur im Speckgürtel: Wohnen wird für viele unerschwinglich
Wildau ist kein Einzelfall: Die Mischung aus Wachstum, teurem Neubau und steigenden Mieten kennt Isabelle Vandre aus vielen Städten. Die Wohnungsexpertin der LINKEN im Landtag beobachtet das mit Sorge: »Bis vor Kurzem hieß es, Brandenburg schrumpft und teure Mieten seien kein Problem – aber das stimmt schon lange nicht mehr.« Zum einen sorge Zuzug dafür, dass viele Regionen wieder wachsen; zum andern treibe Wohnungsspekulation die Preise hoch. »Bezahlbarer Wohnraum ist vielerorts knapp.«
Für Vandre ist es eine der drängendsten Fragen unserer Zeit: »Viele geben so viel Geld für Miete aus, dass sie kaum ihren Lebensunterhalt bezahlen können – von Urlaub oder einer neuen Waschmaschine ganz zu schweigen.« Und die Landesregierung tut nichts: »Immer mehr Sozialwohnungen fallen aus der Förderung, und die Koalition stellt sich taub. Stattdessen streicht sie 15 Kommunen – wie Wildau – aus der Mietpreisbremse und heizt die Lage zusätzlich an.« Entlastungs-Vorschläge der Linksfraktion weise sie stets zurück; etwa ein Verbot, Mietwohnungen in Eigentum umzuwandeln.
Das Problem mit den Altschulden
Eine wichtige Rolle spielen in Brandenburg kommunale Wohnbaugesellschaften wie die REWOGE – ihr gehören über 1 000 Wohnungen in der 8 000-Einwohner-Stadt Rheinsberg. Hier im Norden, fernab der großen Verkehrsadern, ist nicht Zuzug das Problem, sondern Abwanderung – noch immer steht jede zehnte Wohnung leer.
»Solange sich das nicht ändert, haben wir zu kämpfen«, sagt der Geschäftsführer Stephan Greiner-Petter. Doch sein Unternehmen ist unverzichtbar für die Stadt: Viele finden nur hier eine Wohnung, die sie sich leisten können. »Wir halten unsere Mieten bei gut 5 Euro stabil«, so Greiner-Petter. »95 Prozent sind KdU-fähig, also auch für Leistungsempfänger geeignet.« Zudem bietet die REWOGE günstige Nebenkosten, denn ihr Bestand ist klimaneutral: Angeschlossen an die Fernwärme, zeitgemäß gedämmt und oft mit Solarstrom ausgestattet. Wer hier lebt, kann trotz steigender Energiepreise und CO2-Umlage entspannt bleiben.
Als nächstes will das Unternehmen die Barrierefreiheit angehen und mehrere Häuser mit Fahrstühlen ausstatten. Doch das Vorhaben ist teuer: Fast 1 Mio. Euro kostet es – pro Gebäude. Dafür müssen Kredite her, denn eine Förderung des Landes gibt es nicht. Ein Grundproblem: »Bis Ende 2020 waren wir eigentlich ein Sanierungsfall«, erläutert Greiner-Petter. »Inzwischen sind wir wieder bei 17 Prozent Eigenkapital, aber das ist immer noch knapp.«
Eine der Ursachen: Die Altschulden aus dem DDR-Wohnungsbau. »Wir zahlen Schulden für Wohnungen ab, die wir abreißen mussten – sie sind weg, verursachen aber immer noch Kosten.« Insgesamt lasten auf der REWOGE Altschulden von 5,6 Mio. Euro. Greiner-Petter: »Es wäre besser, wenn wir Geld statt in die Schulden in unsere Wohnungen stecken und gleichzeitig die Mieten geringhalten könnten.«
Dem pflichtet auch Isabelle Vandre bei: »In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Landesfonds, der sich genau dieser Altschulden annimmt – so etwas brauchen wir auch in Brandenburg.« Es könne nicht sein, dass jahrzehntealte Verpflichtungen aus DDR-Tagen bis heute Investitionen verhindern. »Das Land muss dieses Problem lösen, damit Geld frei wird für guten, aber bezahlbaren Wohnraum.«
Neue Wohnungen in alten Platten
In Brandenburg an der Havel stellt die WBG Brandenburg eG solchen Wohnraum zur Verfügung. Als Genossenschaft ist sie den Interessen ihrer Mitglieder verpflichtet – denen sie nicht nur eine Wohnung bietet, sondern auch demokratische Mitsprache.
7 500 Wohnungen hat die WBG, rund 14 Prozent davon stehen leer. Das sei auch finanziell ein Problem, erläutert der Vorstand Matthias Osterburg: »An der Abwanderung nach der Wende knabbern wir bis heute. Wir hätten 4,5 Mio. Euro mehr pro Jahr, wenn der Leerstand weg wäre.« Die Lücke führt dazu, dass Geld für Sanierungen knapp ist. Um trotzdem voranzukommen, betreibt die WBG eine ›rollende Sanierung‹, wie Osterburg sagt: »Wir nehmen uns Haus für Haus vor – in 50 Jahren sind wir einmal rum.«
Die frisch sanierten Häuser verfügen über Außendämmung, Fahrstühle und variable Wohnflächen: »Wir haben die ganz normale 2,5-Zimmerwohnung, aber auch 120 qm mit 30-qm-Wohnzimmer. Da staune ich immer selbst, dass sowas geht im Plattenbau.« Hier beträgt die Kaltmiete 7 Euro pro Quadratmeter, doch im teilsanierten Haus mit modernisierter Wohnung geht es ab 4,50 Euro los – im Schnitt liegen Neuverträge bei 5,40 Euro. Mit diesem Spektrum ist die WBG attraktiv für viele Schichten. »Wir vermieten an Transferleistungsbeziehende oder an Leute, die halbtags an der Kasse arbeiten, aber wir haben auch die Mittelschicht. Die soziale Mischung ist wichtig.«
Und Neubau? Dafür seien die Baukosten zu hoch: »Ohne Förderung kämen wir auf bis zu 11 Euro Kaltmiete – zu viel für bezahlbaren Wohnraum in Brandenburg.« Und die Förderung, da schließt sich der Kreis, ist für die Genossenschaft unattraktiv. Osterburg: »Die Anforderungen dafür sind so bürokratisch. Wir können im Bestand zeitgemäßen Wohnraum schaffen und bleiben dabei aus eigener Kraft bezahlbar.«
Auch wegen solcher Probleme fordert Isabelle Vandre einen Kurswechsel in der Wohnungspolitik: »Das bisherige Modell zeitlich befristeter Subventionen für sozialen Wohnungsbau ist gescheitert. Was wir brauchen, ist eine Förderung, die kommunalen Unternehmen und Genossenschaften auch die Sanierung erleichtert. Dann hätten Schulden und Leerstand nicht mehr die hemmende Wirkung wie zurzeit.« So wäre dem Wohnungsbau im ganzen Land geholfen. Damit genug bezahlbarer Wohnraum für alle zur Verfügung steht.